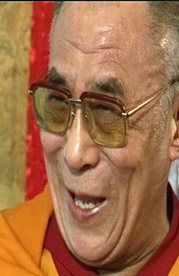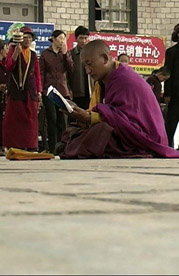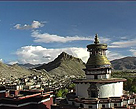PRESSEKRITIKEN
Hamburger Abendblatt
Unbedingt empfehlenswert, dass Tibet-Roadmovie "Die
roten Drachen und das Dach der Welt"
NDR Fernsehen, Kulturjournal
Bedrückende Innenansichten aus Tibet - Der Film "Die Roten
Drachen und das Dach der Welt"
Dieser Film kommt gerade zur richtigen Zeit in die deutschen Kinos.
In "Die Roten Drachen und das Dach der Welt" dokumentieren
zwei deutsche Filmemacher ihre Reise nach Tibet. Sie liefern
Innenansichten aus einem Land, das unerbittlich von den Chinesen
beherrscht wird - lange bevor die jüngste Welle von Gewalt in Tibet
ausbrach. Die beiden haben mit der Kamera festgehalten, wie sie
verborgen unter einer Plastikplane an chinesischen Militärposten
vorbei geschmuggelt werden, über steile Bergpässe zu versteckten
Klöstern wandern und wie die traditionelle Kultur der Tibeter
langsam aus dem Alltag verschwindet.
Badische Zeitung
Tibet auf dem Weg zum Touristenspektakel
Doku: Der Film „Die roten Drachen und das Dach der Welt“ des
Freiburgers Marco Keller
Ein Mädchen in bunten Gewändern steht auf einem öffentlichen
Platz und tanzt, dass die vielen langen Flechtzöpfe fliegen. Ein
buddhistischer Mönch in weinroter Robe hockt mitten im Fußgängergewusel
auf dem Boden und betet, eine Frau vollzieht rituelle
Niederwerfungen. Und vor dem Potala-Palast geht die Sonne auf und
taucht die imposanten Mauern in zartes Licht. Na klar, wir sind in
Lhasa, Tibet. Bilder wie diese flimmern dieser Tage gehäuft über
deutsche Bildschirme, weil der Dailai Lama da ist – in Hamburg
und, am Samstag, in Freiburg. Es sind die Klischees vom „Dach der
Welt“, zu denen natürlich auch majestätische Schneeberge gehören
und ein ernst dreinblickendes Knäblein in gelbem Gewand, das als
wichtige Wiedergeburt erkannt wurde.
All diese Bilder zeigt der Dokumentarfilm „Die roten Drachen und
das Dach der Welt“ auch. Aber er bettet sie ein, zeigt sie als
das, was sie sind: Facetten nur aus dem tibetischen Alltag. Und der
ist weit weniger bunt und erhebend als die mystifizierenden
Vorstellungen des Westens vom pittoresken buddhistischen Völkchen,
das sich lächelnd, betend und meditierend unter chinesischer
Besatzung behauptet. Drei Monate lang waren im Herbst 2004 zwei
Freiburger in Tibet unterwegs: Marco Keller (Regie und Kamera),
Lehrbeauftragter für Filmtheorie und Kameraarbeit an der Pädagogischen
Hochschule, und Ronny Pfreundschuh (Drehbuch, Fotodokumentation),
Realschullehrer und Fotograf.
Begleitet wurden sie von einer Freiburger Ethnologiestudentin –
und bald auch von zwei jungen Schweden, die sich mit ihnen auf den
Weg machten, Tibet zu erfahren. Verfallene Klöster zu besuchen,
Alltag zu erleben in Hunderten von Details: Arbeit und Spiritualität,
Essen und Wohnen, eine natur zwischen gnadenlosen Steinwüsten und
glitzerndem Wasser vor grandiosen weißen Gebirgsketten. Menschen
erzählen zu lassen, von Zwangssterilisation und systematischer
Ausrottung der tibetischen Sprache.
Diese Interviews, mit der Videokamera aufgenommen teils unter großen
Vorsichtsmaßnahmen, machen den Film so eindringlich. Fertig
gestellt wurde er erst diese Tage, zum Dalai-Lama-Besuch: die wohl jüngste
detaillierte Dokumentation des tibetischen Dilemmas zwischen
Tradition und chinesischer Moderne. Ein ruhiger, klug geschnittener
Film, der Emotionen weckt, sie aber nicht schürt und auch Chinesen
zu Wort kommen lässt.
Das Roadmovie im klapprigen Geländewagen führt von Nord nach Süd,
von Golmud in der chinesischen Provinz Qinghai hinein ins so
genannte Autonome Gebiet Tibet mit der Hauptstadt Lhasa und über
den Himalaya nach Nepal. „Wir kamen wie die Chinesen und gingen
wie die Flüchtlinge“, sagt Marco Keller. Das Thema wird augenfällig
in der damals im Bau befindlichen Bahnlinie von Golmud nach Lhasa,
auf der inzwischen auch deutsche Touristen reisen: China überrollt
Tibet.
Vor allem Lhasa. Nur ein winziger Teil der Hauptstadt ist heute überhaupt
noch rein tibetisch geprägt, der Rest sieht aus wie chinesische Städte
auch, mit Shoping Malls, Prachtstraßen, Plätzen. Und auf so einem
tanzt das kleine Mädchen mit den fliegenden Zöpfen. Neben ihr, und
auch das nimmt die Kamera in den Blick, dreht sich ein Betrunkener
mit Schnapsflasche. Touristenbelustigungen, alle beide.
Gabriele Schröder in ihrer Kritik in der Badischen Zeitung vom
27.07.07, zur Filmfassung 2007
MAINPOST
Unzensierte Bilder aus Tibet
Der Film „Die roten Drachen und
das Dach der Welt“ wurde am Samstag, dem Welttag der
Pressefreiheit, an dem China als „größtes Gefängnis für
Journalisten“ bezeichnet wurde, im Cinemaxx erstmals aufgeführt.
Marco Keller und Ronny Pfreundschuh,
die bei der Würzburger Premiere anwesend waren, hatten den Film
ohne jegliche Genehmigung in China gedreht – hätten sie nach
einer Erlaubnis gefragt, wäre der Film nie entstanden. Einige
Monate waren sie vor 2006 dort unterwegs, genauere Angaben dazu
machen sie nicht, um ihre Helfer in Tibet nicht zu gefährden. Der
Zeitpunkt der Veröffentlichung ist jedoch nicht zufällig gewählt:
„Momentan geht es der chinesischen Regierung darum, im Westen
ihr Gesicht zu wahren, während sie in Tibet Demonstrationen
niederknüppeln. Es besteht die Gefahr, dass das bei den
Olympischen Spielen und danach schnell wieder vergessen wird“,
so Ronny Pfreundschuh.
Die beiden Filmemacher stammen aus
Tauberbischofsheim, trafen sich in Freiburg wieder und
beschlossen, das Projekt zu wagen. Marco Keller hatte vorher schon
in anderen Teilen der Welt gefilmt, Ronny Pfreundschuh hatte sich
schon länger mit dem Thema Tibet auseinandergesetzt. Sie reisten
als Touristen nach China, schlugen sich per Bahn nach Tibet durch,
schlossen sich immer wieder anderen Reisegruppen an, um nicht
aufzufallen. Sie ließen sich unter Planen auf einem Pickup an
bewaffneten Polizeiposten vorbei schmuggeln und übernachteten auf
über 5000 Metern Höhe bei Gewitter und Regen in Zelten.
Die Cinemaxx-Premiere moderierte
Dr. Eva Kuczewski-Anderson an, die Sprecherin der Tibet-Initiative
Würzburg, die die beiden bei diesem Film unterstützt hatte und
im Foyer des Kinos gemeinsam mit Amnesty International über die
zahlreichen Verletzungen der Menschenrechte in China aufklärte.
Die fast 200 Zuschauer sahen
anschließend teilweise unkommentierte Bilder, die für sich
selbst sprachen, Interviews mit Tibetern in ihrem Land und im Exil
in Nepal, mit Chinesen, mit dem Zuständigen für das UN-Flüchtlingslager
für Tibeter in Kathmandu und gar mit dem Dalai Lama – nach
langem Hin und Her kam das in Deutschland zustande, eine Ehre für
die Filmemacher.
Bizarr wirkten die chinesischen
Touristinnen vor einem tibetischen Kloster, die sich vor der
Attraktion fotografieren ließen, während eine gläubige
Tibeterin auf Knien darauf zurutscht oder die gläsernen Häuserfassaden
chinesischer Großstädte neben dem Potala-Palast in Lhasa.
Schrecklich die Bilder eines rumänischen Kamerateams, die
filmten, wie eine Gruppe Tibeter über den Himalaya nach Nepal flüchtet
und eine 17-jährige Nonne von chinesischen Grenzpolizisten
erschossen wird – die einzige Szene, die Keller und Pfrundschuh
nicht selbst drehten.
Am Ende mussten sich die beiden
zahlreichen Fragen der Zuschauer stellen. Ähnlich unzensierte
Bilder aus der Region dürften so bald kaum mehr irgendwo zu sehen
sein.
Beate Spinrath
Brennpunkt Tibet
Unter den zahlreichen Filmen, die es über
Tibet inzwischen gibt, ist zwei jungen Freiburger Filmemachern etwas
ganz Besonderes gelungen: Sie haben sich heimlich und ohne
Drehgenehmigung durch China und Tibet bewegt und zeichnen dabei ein
Bild des Landes, das dokumentiert, wie China Tibet sehen möchte,
und wie die Realität hinter den äußeren Erscheinungsformen
aussieht. Menschen, die sich vor Tempeln und Statuen niederwerfen
und dabei glücklich versunken wirken, könnten der Beweis für
praktizierte Religionsfreiheit sein, doch die Filmemacher schauen näher
hin und decken Widersprüche auf. In unaufdringlichen Gesprächen,
aber auch in eindrucksvollen Bildern vom Ausmaß der Sinisierung
unter der chinesischen Dominanz in allen gesellschaftlichen
Bereichen, wird Tibet realistisch nahe gebracht, ohne dass der Film
jemals Gefahr läuft, ins Agitatorisch-Plakative abzugleiten. Es ist
ein sensibler Film, bei dem sich die Autoren zurückhalten und die
Menschen zu Wort kommen lassen; Tibeter wie Chinesen.
Klemens Ludwig
KINOZEIT
Ein filmischer Reisebericht aus Tibet
Seit den Aufständen der vergangenen Monate ist Tibet wieder
einmal ins Zentrum des Interesses der Weltöffentlichkeit gerückt.
Es kommt zu Appellen, Beschlüssen, Resolutionen, zu Aufrufen, die
letzten Endes doch nichts bringen werden, da sie – wie stets –
mit dem Hinweis auf die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu
China, meist nur Absichtserklärungen sind. Wie es im Innern Tibtes
aussieht, weiß niemand, da alle ausländischen Journalisten während
der Unruhen ausgewiesen wurden. Trotzdem: Das Interesse an dem Land,
das auch das Dach der Welt genannt wird, ist riesig, politisches
Bewusstsein mischt sich mit Phantasien, mit Glorifizierungen, mit Träumen
von spiritueller Klarheit, die in unserer westlich geprägten Welt
nicht mehr erlebbar ist.
Die beiden Freiburger Studenten Marco Keller und Ronny Pfreundschuh
waren im Herbst des Jahres 2004 drei Monate lang in Tibet unterwegs
und haben ihre Reise heimlich mit der Kamera dokumentiert – in
einer Zeit also, als die Aufstände der jüngsten Zeit noch in
weiter Ferne lagen. Trotzdem bekommt man einen guten Eindruck davon,
auf welche Weise die Chinesen Einfluss auf Land und Leute nehmen.
Oft sind es Szenerien, die aus dem fahrenden Auto heraus gefilmt
wurden, was einerseits der Illegalität des Films geschuldet sein dürfte,
andererseits den Eindruck eines Road Movies verstärkt. Sie zeigen
Szenen aus dem Alltag der Tibeter, zeigen quasi im Vorübergehen
eine Aktion, mit der die Chinesen bis zum Jahre 2010 Hochchinesisch
zur alleinigen Landessprache machen wollen, sie illustrieren die
Gegensätze zwischen Tradition und eilig vorangetriebener
Industrialisierung und Erschließung des Landes.
Ruhig und bedächtig ist der Film geworden, wie bei einem Puzzle
ergeben sich immer wieder Ausschnitte, die sich erst bei genauerem
Hinsehen zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Wo die Sympathien der
beiden Freiburger liegen, das ist dem Film deutlich anzumerken, auch
wenn sich Marco Keller und Ronny Pfreundschuh mit offenen Statements
merklich zurückhalten. Doch die Bilder eines Flüchtlingslagers in
Katmandu sprechen Bände, ebenso die Allgegenwärtigkeit der
Chinesen im Straßenbild und die Subtilität der Maßnahmen, die den
Anspruch Chinas, Befreier und nicht Besatzer Tibets zu sein,
konterkarieren. Die verschiedenen Interviews, die die meist zufällig
gefundenen Eindrücke ergänzen und vertiefen, entstanden unter größten
Sicherheitsmaßnahmen und werden dort politisch und konkret, wo es
die Bilder nicht sein können. Doch es kommen keineswegs nur Tibeter
zu Wort, sondern auch Chinesen, deren Bild der Lage naturgemäß ein
ganz anderes ist. Sie preisen die Fortschritte, die die Zivilisation
des Landes machen, die von den Tibetern als Gefährdung und Unterdrückungsmaßnahmen
wahrgenommen werden. Auf diese Weise entsteht ein stimmiges Bild der
Lage, das jenseits der aktuellen Entwicklungen das Dilemma
verdeutlicht, in dem sich Tibet befindet.
Gerade deswegen aber ist Die Roten Drachen und das Dach der Welt
ein wichtiges Dokument einer Kultur zwischen Tradition und Moderne,
zwischen Spiritualität und Unterdrückung. Vielen Tibetern bleibt
angesichts der unvereinbaren Widersprüche nur noch der mühsame Weg
ins Exil – ein Weg, den mancher von ihnen nicht überlebt.
Joachim
Kurz
Casablanca
„Wir kamen wie die Chinesen und gingen wie die Flüchtlinge"
- das dokumentarische Roadmovie der beiden Freiburger Marco Keller
und Ronny Pfreundschuh ist nicht nur das hochaktuelle Dokument einer
dreimonatigen Reise im klapprigen Geländewagen durch Tibet von
Norden nach Süden, sondern wurde, dank moderner Kameratechnik,
heimlich und ohne Drehgenehmigung aufgezeichnet.
Kinomatch, Die Publikumsmeinung
Die roten Drachen und das Dach der Welt
Zwei junge Filmemacher reisten ohne Drehgenehmigung durch China und
Tibet. Sie brachten einen Film mit, der Chinesen wie Tibeter zu Wort
kommen lässt und damit die plakative Agitation vermeidet.
Ein spannendes Projekt ist das,
und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Es gibt zwar viele
Filme über Tibet, doch die Tonalität des Dokumentarfilms von Marco
Keller und Ronny Pfreundschuh ist schon einzigartig.
Frankfurter Rundschau
Reisebericht aus Tibet
Mosaiksteine am Wegesrand
Nachdem die Geschichte Tibets unter der chinesischen Okkupation
lange nur in Fachkreisen diskutiert wurde, steht das Thema
mittlerweile weltweit auf der Tagesordnung. Nicht selten gehen dabei
Menschenrechtsfragen und Legendenbildung Hand in Hand: Zum einen,
weil die Abschottungspolitik der chinesischen Behörden der
Spekulation neue Nahrung gibt, zum anderen, weil die Sehnsüchte der
Zivilisationsmüden schon immer gerne ins tibetische Hochland führten.
Aus dem Blickwinkel mancher Esoteriker setzt die chinesische
Spielart des Raubtier-Kapitalismus nur die Verwüstungen der
Kulturrevolution unter anderem Namen fort.
Ein Land auf Augenhöhe
In
Zeiten politischer Zensur kommt einem Reisebericht, wie ihn Marco
Keller und Ronny Pfreundschuh mit "Die roten Drachen und das
Dach der Welt" heimgebracht haben, besondere Bedeutung zu. Natürlich
konnten sich auch die mit touristischen Visa nach Tibet gereisten
Filmemacher nicht frei bewegen, und was sie mit ihrer einfachen
Digitalkamera an Mosaiksteinen aufsammeln, ist allein der Zufälligkeit
ihrer Reiseroute geschuldet. Dennoch sind sie der tibetischen
Wirklichkeit näher als die etablierten Medien: Man sieht die
Attraktionen des Landes auf Augenhöhe, taucht in die ebenso karge
wie schöne Landschaft ein und wohnt bedrückenden Straßenszenen
bei. Sowohl in den spärlichen Erläuterungen wie auch in den Bildern machen die
Filmemacher keinen Hehl aus ihrer Zuneigung zur alten tibetischen
Kultur und beziehen in diesem Sinne politisch Position.
Unbestreitbar stellt die Modernisierung eines rückständigen
Gebiets einen gewalttätigen Eingriff dar - gerade in den Städten
wirken die Tibeter wie Randfiguren einer radikal veränderten
Umgebung.
Wie in Nordamerika
In einem Interview abseits der Wanderroute nennt ein Vertreter der
tibetischen Exilregierung die chinesische Zugverbindung nach Lhasa
in einem Atemzug mit der Besiedlung Nordamerikas. Dieser Vergleich
fasst die Bedrohung der traditionellen tibetischen Lebensweise
treffend zusammen und bringt zugleich eine mythologische Komponente
ins Spiel, die je nach Standpunkt einen grausamen Völkermord oder
eine bedeutende Zivilisationsleistung zum Inhalt hat. Zwischen
diesen Polen bewegt sich auch die gegenwärtige Kontroverse zur
Tibet-Frage. Keller und Pfreundschuh versuchen zumindest, die
Entfernung zwischen ihnen auszumessen.
Michael Kohler
Zeitung Bamberg
Geht über der Altstadt von Lhasa die Sonne auf, um den
Potala-Palast in ein zartes Licht zu tauchen, dann entspricht das
sicher Klischees, die viele mit der Heimat des Dalai Lama verbinden.
Auch der Dokumentarfilm „Die roten Drachen und das Dach der
Welt“ transportiert solche Bilder, die den Zauber Tibets zeigen,
dazwischen bringt er den Kinobesuchern aber auch andere Facetten aus
dem tibetischen Alltag nahe, „der weniger bunt und erhebend ist
als die mystifizierenden Vorstellungen des Westens von
friedliebenden Mönchen“, wie die Filmemacher Marco Keller und
Ronny Pfreundschuh erfahren mussten. Jetzt nutzten sie die besondere
Aufmerksamkeit über die Olympischen Spiele, um sich mit ihrem Film
für Veränderungen stark zu machen. Ein Porträt, das den Alltag in
einem mehr und mehr von Chinesen dominierten Land zeigt, schwebte
den beiden vor. Wobei Keller und Pfreundschuh neben Tibetern auch
Chinesen zu Wort kommen lassen.
Am Ende zeigten sich viele Kritiker von der Dokumentation mehr als
angetan. Das Hamburger Abendblatt schwärmte „unbedingte
empfehlenswert“. Unbedingt empfehlenswert ist somit auch ein
Kinobesuch, bei dem alle Interessierten mehr über die Enstehung des
Films erfahren können. Am Samstag besuchen Keller und Pfreundschuh
ab 19 Uhr das Lichtspiel.
Petra Mayer
Filmdienst
Nachdem die Geschichte Tibets unter der chinesischen Okkupation in
den letzten Jahren vornehmlich in Fachkreisen diskutiert wurde, hat
eine Reihe aktueller Ereignisse das Thema dauerhaft auf die
politische Tagesordnung gesetzt. Nicht selten gehen dabei
Menschenrechtsfragen und Legendenbildung Hand in Hand, wie indirekt
auch eine Interviewpassage aus Marco Kellers und Ronny Pfreundschuhs
Dokumentarfilm zeigt: Ein Vertreter der tibetischen Exilregierung
nennt darin die mit enormem Aufwand errichtete chinesische
Zugverbindung ins tibetische Hochland in einem Atemzug mit der
Eroberung des amerikanischen Westens durch europäische Siedler –
und dem daraus resultierenden Untergang der indianischen Kultur.
Dieser historische Vergleich fasst die Bedrohung der traditionellen
tibetischen Lebensweise treffend zusammen und bringt zugleich eine
mythologische Erzählung ins Spiel, die, je nach Standpunkt, einen
grausamen Völkermord oder eine bedeutende Zivilisationsleistung zum
Inhalt hat. Zwischen diesen Polen bewegt sich die gegenwärtige
Kontroverse zur Tibet-Frage, wobei die zu Recht viel gescholtene
Abschottungspolitik der chinesischen Behörden der Spekulation verlässlich
neue Nahrung gibt.
In Zeiten
politischer Zensur kommt einem Reisebericht, wie ihn die Regisseure
aus Tibet heimgebracht haben, besondere Bedeutung zu. Natürlich
konnten sich auch die mit touristischen Visa nach Tibet gereisten
Filmemacher nicht frei bewegen, und was sie mit ihrer einfachen
Digitalkamera an Mosaiksteinen aufsammeln, ist allein der Zufälligkeit
ihrer Reiseroute geschuldet. Dennoch kommen sie der tibetischen
Wirklichkeit näher als die etablierten Medien: Man sieht die
klassischen Attraktionen des Landes aus etwas anderer Perspektive,
taucht in die ebenso karge wie schöne Berglandschaft ein, begegnet
in einem Kleinkind einem wiedergeborenen Lama und wohnt bedrückenden
Straßenszenen mit betrunkenen Arbeitslosen bei. Sowohl in den spärlichen
Erläuterungen als auch in den Bildern machen die Reisenden keinen
Hehl aus ihrer Zuneigung zur tibetischen Kultur und beziehen in
diesem Sinne politisch Position. Unbestreitbar stellt die
Modernisierung eines rückständigen Gebiets einen gewalttätigen
Eingriff dar – vor allem in den Städten wirken die Tibeter wie
Randfiguren einer radikal veränderten Umgebung.
Die
Tibet-Frage wird im Westen auch deswegen so dringlich verhandelt,
weil sich die Sehnsüchte und Fantasien der Zivilisationsmüden
bevorzugt zum Dach der Welt geflüchtet haben: Aus dem esoterischen
Blickwinkel wirkt die chinesische Form des Raubtier-Kapitalismus
wohl nur wenig besser als die Verwüstungen der überwundenen
Kulturrevolution. Keller und Pfreundschuh halten sich hier mit ihrem
Urteil weitgehend zurück, wie sie auch in den Interviews abseits
der Wanderroute, etwa mit dem Dalai Lama, das Dogmatische meiden.
Trotzdem erscheint das Konzept, die Aussagen zufälliger und weniger
zufälliger Reisebekanntschaften zu einem Kommentar zu verknüpfen,
nicht durchweg gelungen. Zu oft werden bekannte Positionen lediglich
in ungelenken Worten wiederholt und historische Zusammenhänge stark
verkürzt wiedergegeben. Am eindrucksvollsten ist der Film, wenn die
Alltagsbilder sprechen. Deren aktueller Nachrichtenwert mag zwar
begrenzt sein, doch öffnen sie die Augen für die nicht nur durch
Zensurmaßnahmen, sondern auch durch hartnäckige Legendenpflege
verborgene tibetische Normalität.
Michael Kohler
CHOICES
Die roten Drachen und das Dach der Welt
Marco Keller nähert sich in seinem Dokumentarfilm Tibet nicht durch
die verträumt romantische, westliche Sicht. Über Pilgerströme
begibt er sich ins Detail, hält den Alltag der Mönche fest,
interviewt Tibeter und Chinesen und reißt die Konflikte an:
Kolonialisierung, Flucht, Exil. Keller betreibt ein Stück weit
Entmystifizierung und zeigt, was heute von Tibet übrig ist.
(he)
Hamburger
Abendblatt
Unterdrücktes Tibet
Dokumentation Marco Kellers und Ronny Pfreundschuhs "Die roten
Drachen" zeigt das Leben auf dem Dach der Welt
Schmucklose Betonwohnhäuser, von Menschen überquellende
Einkaufsstraßen, überall riesige Transparente und ein
Verkehrschaos. Würde über allem nicht die beeindruckende Kulisse
des Potala-Palasts aufragen, könnte man Lhasa für eine normale
chinesische Provinzstadt halten.
Drei Monate lang waren die beiden
Freiburger Marco Keller und Ronny Pfreundschuh im Herbst 2004 in der
Hauptstadt Tibets unterwegs, um den Alltag auf dem Dach der Welt
kennenzulernen. In dieser Woche kommt ihr Film "Die roten
Drachen und das Dach der Welt" gerade zum richtigen Zeitpunkt
ins Kino: Er zeigt Bilder aus einem Land, das einer rasend schnellen
Modernisierung unterzogen wird und in dem sich die Tibeter selbst
nur noch wie eine pittoreske Minderheit vorkommen.
Noch immer vollziehen gläubige
Buddhisten vor Tempeln und Stupas die rituellen Niederwerfungen. Im
Gewühl der Einkaufsstraßen mischen sich ländliche Pilger mit
modern gekleideten Angestellten und jungen Familien. Aber aus
Lautsprechern tönen Ansagen wie "Wir verlangen
Hochchinesisch".
Ein Tibeter erzählt, nur zwei Kinder
pro Familie seien den Einheimischen erlaubt. Zwar dürfen die Klöster
eine begrenzte Zahl von Nonnen und Mönchen aufnehmen, aber sie müssen
sich einer chinesischen "patriotischen Erziehung"
unterwerfen.
Zahlreiche Tibeter versuchen trotz
eines Ausreiseverbots, über die Schneepässe des Himalaja nach
Nepal und weiter nach Indien zu gelangen, um den Dalai Lama zu
besuchen. Ein Weg, auf dem chinesische Militärpatrouillen schon
warten - für etliche Flüchtlinge endet der Versuch tödlich.
Keller und Pfreundschuh filmten ohne
Drehgenehmigung, zum Teil mussten sie die Gesichter ihrer
Interviewpartner ausblenden.
Ihr Film ist kein ausgefeilter,
aufwendig nachbereiteter Dokumentarfilm. Aber er vertieft sehr
anschaulich das Verstän
dnis für die Gegensätze, die derzeit in Tibet aufeinanderprallen
und sicher noch für lange Zeit für politischen Zündstoff sorgen
werden.
Irene
Jung
Mit versteckter Kamera aufgenommene Bilder aus Tibet
Die Macher des Filmes «Die
roten Drachen und das Dach der Welt» berichteten in Nürnberg über
ihre Dreharbeiten
NÜRNBERG - Heimkehr der Bilderschmuggler: Mit der versteckten
Kamera reisten zwei Freiburger durch Tibet, um die Wahrheit über
das Land jenseits von Klischees und Vorurteilen kennenzulernen.
Jetzt stellten sie ihren Film «Die roten Drachen und das Dach der
Welt» im Cinecittà vor.
Spätestens seit dem Ausbruch der Unruhen hat wohl jeder ein Bild
von Tibet im Kopf. Meist ein vages Bild, von orange gekleideten Mönchen
und uniformierten Chinesen, die in karger Landschaft zur
beispielhaften Konfrontation zwischen Spiritualität und
Materialismus anzutreten scheinen.
Wissen, wie Tibet wirklich ist
«Wir wollten wissen, wie Tibet wirklich ist - uns ein eigenes Bild
machen», erklären Marco Keller und Ronny Pfreundschuh, die an der
Freiburger Hochschule für Pädagogik arbeiten. Wann genau sie in
Tibet waren, wollen sie nicht sagen - um ihre oft anonymen
Interviewpartner zu schützen, die Angst vor Gefägnis und Folter
haben.
Es war aber zur Zeit des Baus der Eisenbahn nach Lhasa, als die
beiden Deutschen mit versteckter Kamera und ohne offiziellen Führer
(was inzwischen nicht mehr möglich ist) über China nach Tibet
fuhren.
«Uns war es wichtig, auch China kennenzulernen und mit Chinesen zu
sprechen», meint Pfreundschuh. «Wir wollten keine Schwarz-Weiß-Malerei
machen, denn wir haben in China viel echte Herzlichkeit erlebt!»
Und so nimmt man es den Chinesen im Film auch durchaus ab, dass sie
nicht in diesen unwirtlichen Landstrich mit der dünnen Luft
gekommen sind, um die Tibeter zu ärgern, sondern um hier für das
Wohl des Vaterlandes zu arbeiten und die Situation vor Ort zu
verbessern.
Mönche per Video überwacht
Wir sehen aber auch die andere Seite: Eine Frau, die 15 Jahre im Gefängnis
war, weil sie öffentlich für den Dalai Lama Stellung bezog, eine
chinesische Journalistin, die einem kleinen Jungen vorspricht, was
er in die Kamera sagen soll: «Unser Land braucht eine starke
Verteidigung!». Und man sieht Mönche, die bei ihren rituellen
Diskussionen per Video überwacht werden. Am schockierendsten sind
die Bilder tibetischer Flüchtlinge, die zu Fuß über die
Schneeweiten des Mount Everst laufen, um das Land zu verlassen - und
dann von chinesischen Scharfschützen niedergeschossen werden.
«Wir sagen nicht: So ist Tibet», betont Marco Keller am Ende des
Films. «Aber: das ist Tibet wie wir es gesehen haben.» Am Ende
ihrer Reise sind die beiden Männer überzeugt: «Es muss sich etwas
ändern. Und vielleicht bietet sich durch die Olympischen Spiele die
Chance dazu - wenn die internationale Aufmerksamkeit bleibt und wächst.»
Peter Romir
Hamburger
Abendblatt
Einblicke
Zwei deutsche Filmemacher haben den Alltag in Tibet festgehalten -
eine Reise ins Detail
Ein Land im Griff des roten Drachen
Modernisierungsdrang
und Machtanspruch Chinas drohen die jahrhundertealte Kultur des
Berglandes vollends zu verdrängen. Abendblatt-Autorin Irene Jung über
einen aufschlussreichen Dokumentarfilm und das Tibet von heute.
In dem verwitterten buddhistischen Kloster ist ein Raum besonders
liebevoll hergerichtet: Holzwände in freundlichen Farben, Schonbezüge
auf den Stühlen. Auf einem Sessel thront ein etwa vierjähriges
Kind in quietschgelber Jacke und spielt mit einer kleinen Plüschkatze.
Der Junge gilt als Reinkarnation eines wichtigen Lamas, ist also
schon jetzt ein spiritueller Lehrer. Erstaunt betrachtet das Kind
die Besucher, die aus dem fernen Westen gekommen sind, die Besucher
blicken staunend zurück. Gesagt wird nichts.
Die Szene aus dem Dokumentarfilm "Die roten Drachen und das
Dach der Welt" wirkt wie ein Schlüssel zum Verhältnis des
Westens zu Tibet: Verwundert und mitfühlend ist unser Blick auf
dieses fremdartige Land der Sechstausender. Aber was sich jenseits
der Jurtenromantik im Alltag der Tibeter abspielt, bleibt Ausländern
weitgehend verborgen. Der kleine Lama zum Beispiel lebt im
benachbarten Nepal - in Tibet werden selbst die Reinkarnationen
staatlich kontrolliert.
Mit Rucksäcken und normalen Digital-Filmkameras sind die Freiburger
Filmemacher Ronny Pfreundschuh (28) und Marco Keller (31) durch
Tibet gereist, per Bahn, zu Fuß und in klapprigen Lkw. Sie
befragten Mitreisende, tibetische Pilger, Dorfbewohner und Mönche,
chinesische Touristen und Offizielle - so gut es mithilfe spontaner
Übersetzer ging. Das war Ende 2004, die Unruhen in Tibet Anfang März
2008 haben sie nicht erlebt.
Aber ihre Bilder und Gespräche machen begreifbar, was sich in Tibet
vollzieht: der Zusammenprall eines lange isolierten Berglandes mit
dem ehrgeizigen Modernisierungsdrang eines Global Players; der
Konflikt zwischen Glauben und Rationalismus, zwischen Tradition und
Propaganda.
Zum Beispiel in Lhasa. Zu Füßen des imposanten Potala-Palastes stoßen
die Filmemacher auf eine chinesische Militärmaschine, Teil einer
offiziellen Ausstellung zur "Landesverteidigung". Im
Stadtzentrum quält sich ein Team des chinesischen Staatsfernsehens
gerade mit einer Straßenumfrage zum selben Thema ab. Mangels
begeisterter Antworten wird sogar ein Kind gefragt, ob es nicht
stolz sei auf so viel Sicherheit.
An einer anderen Ecke stehen tibetische Schulkinder aufgereiht vor
einem Spruchband: "Im Jahr 2010 sprechen wir alle
Hochchinesisch!" Wenn Tibeter einkaufen oder bei der Bank etwas
einzahlen, müssen sie chinesisch sprechen, Formulare in tibetischer
Sprache gibt es nicht. Briefe müssen chinesisch beschriftet sein,
sonst werden sie nicht zugestellt.
In mühevoller Nacharbeit ließen Keller und Pfreundschuh Plakate
und Interviews in Deutschland von Chinesen und Tibetern übersetzen.
Und dabei gab es einige Überraschungen. Auf einem Spruchband in
Lhasa stand: "Vergesst nicht, dass wir hier sind, um euch zu überwachen!"
"Wir haben bei unserem chinesischen Übersetzer
nachgefragt", sagt Ronny Pfreundschuh, "es heißt tatsächlich
bewachen und nicht beschützen. Er war selber ganz schockiert. Er
hatte nicht geglaubt, dass ein Spruchband drohend klingen
sollte."
Keller und Pfreundschuh reisten mit der Lhasa-Bahn ins Land, die
Peking seit 2006 mit Tibets Hauptstadt verbindet. Gebaut wurde die
Bahntrasse ausschließlich von chinesischen Arbeitskräften. Heute
verkehren bis zu acht Züge pro Tag in jeder Richtung. Im Sommer
bringen sie Schätzungen zufolge täglich 2000 bis 3000 Immigranten
aus China nach Tibet.
Modernisierungsdrang und Machtanspruch Chinas drohen die
jahrhundertealte Kultur des Berglandes vollends zu verdrängen.
Abendblatt-Autorin Irene Jung über einen aufschlussreichen
Dokumentarfilm und das Tibet von heute.
"Die meisten sind verarmte Glückssucher, die durch Chinas
drastische Urbanisierungspolitik von ihrem Land vertrieben
wurden", schreibt die tibetische Exilregierung in einem Bericht
aus diesem Jahr. "Sie sind entschlossen, jede mögliche Nische
zu besetzen, und verdrängen Tibeter selbst vom kleinen Straßenhandel."
Im
Film zieht Kelsang Gyaltsen von der Exilregierung die Parallele zur
Erschließung Nordamerikas: Auch dort brachte die Eisenbahn Tausende
"Pioniere" in den Wilden Westen, um Land zu besiedeln -
ohne Rücksicht auf die Urbevölkerung und ihre Kultur.
Schon Maos Nachfolger Deng Hsiao Ping war 1987 überzeugt:
"Tibet kann sich nicht allein entwickeln"; man brauche
"eine große Zahl von Han-Genossen", um Know-how nach
Tibet zu bringen und "Tibets Arbeitskräfte zu
trainieren". Heute wird die Ansiedlung von Chinesen gezielt mit
dem "Hukou-System" gefördert. Diese
Registrierungsvorschrift in China soll vor allem die unkontrollierte
Stadtflucht von Bauern eindämmen. Arbeiter und Bauern bekommen überall
in China sofort einen Hukou für tibetische Städte - Tibets Landbevölkerung
hingegen bleibt davon ausgeschlossen, heißt es im Bericht zur
"Lage der Menschenrechte in Tibet" 2003/4. Auf dem
privaten Wohnungsmarkt in den schnell wachsenden Städten gelten
Tibeter vom Lande als Mieter zweiter Klasse, als Habenichtse.
Und die Klöster? Von 6259 Klöstern mit einer halben Million Mönche
und Nonnen, die es noch 1959 in Tibet gab, wurden während der
Kulturrevolution rund 6000 zerstört. Inzwischen hat man einige der
erhaltenen zum Teil aufwendig restauriert, denn sie sind der
Touristenmagnet. Junge Mönche, die im Film unkenntlich bleiben müssen,
erzählen, wie streng diese zugelassenen Klöster kontrolliert
werden.
KP-geführte Komitees regeln die begrenzte Aufnahme von Mönchen und
Nonnen, die Klosterfinanzen und sogar, welche Feste gefeiert werden
dürfen. Novizen müssen sich einer "patriotischen
Erziehung" unterwerfen. Dazu gehört die Abkehr von der
"Verehrung des Dalai Lama", stattdessen "Liebe zum
großen Mutterland". Beides ist mit dem Anspruch innerer
Befreiung, der Kernidee auch des lamaistischen Buddhismus, nicht
vereinbar.
Gegenüber den sensibel montierten O-Tönen im Film wirkt die
chinesische Propaganda wie eine bunte Lärmkulisse. Sie soll vor
allem die große Mehrheit der Han-Chinesen davon überzeugen, dass
in der armen Westprovinz viel Gutes getan wird. Und auf den ersten
Blick stimmt das ja auch.
China argumentiert, dass es Tibet 1959 aus "mittelalterlicher
feudaler Sklaverei" befreit habe. Richtig ist, dass es in Tibet
in den 50er-Jahren kein weltliches öffentliches Bildungssystem für
die breite Bevölkerung gab. Die medizinische Versorgung beschränkte
sich auf traditionelle Heilmethoden.
Aber
jeder Fortschritt hat zwei Versionen.
Nach
offiziellen chinesischen Angaben gibt es heute in Tibet 4360 Schulen
aller Grade, darunter 4250 Primar- und vier Hochschulen. Allerdings
können die Schulgebühren pro Jahr mehrere Monatsgehälter
betragen. Tibetische Flüchtlingskinder berichten von einer hohen
Abbrecherquote und von Benachteiligung gegenüber chinesischen
Mitschülern. Zahlen über tibetische Absolventen sind nicht verfügbar.
Offiziell gab es Ende 2006 in Tibet 903 Gesundheitseinrichtungen,
darunter 763 Krankenhäuser und Sanitätsstationen. Allerdings: Die
Behandlung ist nicht kostenlos. Wer nicht genug Geld hat, werde
abgewiesen, berichten Tibeter. Viele Erwachsene haben noch nie im
Leben einen Arzt gesehen.
Die Säuglingssterblichkeit in Tibet sank nach offiziellen Angaben
seit 1959 von damals 430 auf heute 24,3 pro tausend Geburten.
Erstaunlich: Diese Zahl entspricht dem Landesdurchschnitt. Ärzte
und Expertenkommissionen, die Tibet besuchen durften, halten sie für
völlig unglaubhaft in einem Land, in dem mehr als 80 Prozent der
Einwohner als Nomaden oder auf Dörfern in entlegenen
Hochgebirgsregionen leben. Sie berichten im Gegenteil von einer
erschreckend hohen Mütter- und Säuglingssterblichkeit und einer
Zunahme von Tuberkulose.
Stolz teilt Peking mit, dass es in Tibet jetzt auch eine Renten-,
Kranken- und Berufsunfallversicherung sowie den Mutterschutz eingeführt
hat. Es gibt aber keinerlei Angaben, ob und wie viele ländliche
Tibeter davon profitieren.
Modernisierungsdrang und Machtanspruch Chinas drohen die
jahrhundertealte Kultur des Berglandes vollends zu verdrängen.
Abendblatt-Autorin Irene Jung über einen aufschlussreichen
Dokumentarfilm und das Tibet von heute.
Trotz aller "Modernisierungs"-Kampagnen ist der gewünschte
Erfolg bisher auch ausgeblieben. Nach dem "China Human
Development Report 2005" der Uno, an dem chinesische Experten
mitarbeiteten, ist Tibet heute noch das Schlusslicht aller Provinzen
in Sachen Gesundheit, Bildung und sozialer Sicherung. Die
Lebenserwartung der Tibeter, mit 65 Jahren die niedrigste in China,
liegt zehn Jahre unter der in anderen ländlichen Regionen. Die
Analphabetenrate ist mit 47 Prozent (Frauen: über 60 Prozent)
landesweit die höchste. Und die offiziellen
Arbeitsbeschaffungsprogramme zielen nicht auf Tibeter, sondern auf
qualifizierte Verwaltungskräfte und Hochschulabolventen - Chinesen.
"Die
roten Drachen und das Dach der Welt" läuft im Hamburger
Abaton-Kino.
Irene
Jung,
erschienen am 19. Mai 2008
|
|

Vor dem Potala Palast in Lhasa weht die chinesische Flagge |
|